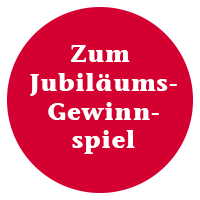Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen.
50 Jahre Biofarm
Sie waren spannend, diese 50 Jahre Biofarm Genossenschaft!
Einige dieser interessanten Geschichten und Zeitdokumentationen möchten wir gerne mit Ihnen teilen.
Auf dieser Seiten finden sie jeden Monat neue Informationen, Geschichten und Anekdoten rund um Biofarm. Steigen Sie ein in eine Zeitreise von 1972 bis 2022.
Gründer haben ihre Gründe
Am 8. Mai 1972 versammeln sich im Hotel-Restaurant Kreuz in Herzogenbuchsee BE neun Männer. Sie legen den Grundstein für die Biofarm. Einer von ihnen ist Werner Scheidegger, erster Präsident und Geschäftsführer. Auf seinem Hof in Madiswil BE werden das erste Büro und dazu das erste Lager der jungen Genossenschaft eingerichtet.
Gründungsmitglied Werner Scheidegger erinnert sich: «In den 50er- und den 60er-Jahren war die Biobauernbewegung sehr gut vernetzt. Hans Müller, Biologe, Sekundarlehrer und Nationalrat, hatte 1926 von seiner Partei, der damaligen Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei, den Auftrag erhalten, die Schulung der jungen Generation zu übernehmen. Mit seiner Frau Maria Müller-Bigler und zusammen mit dem deutschen Arzt Hans Peter Rusch legte er im Schulgarten auf dem Möschberg das Fundament zum heutigen Biolandbau. Dort nahmen jeweils viele Interessierte an Tagungen teil. Hier haben wir späteren Gründer uns kennengelernt. Nach dem Tod von Maria Bigler 1969 entstand eine grosse Lücke. Wir wurden uns bewusst, dass diese Frau die treibende Kraft im Schatten ihres Mannes gewesen war. Weil Hans Müller trotz seines hohen Alters weder seine Nachfolge noch diejenige für seine Frau geregelt hatte, waren wir jungen Bauern uns einig: Wir sind selber gefordert, den biologischen Landbau weiter zu bringen.»
«Endlich wird jemand aktiv!»
Im Biolandbau ist die giftfreie Unkrautbekämpfung seit jeher ein grosses Thema. Einige Jungbauern beschliessen, die Abflammtechnik weiter zu entwickeln und suchen nach möglichen Absatzwegen für Milch und Fleisch. Während Ersteres umsetzbar scheint, stehen Zweiterem gesetzliche Vorschriften im Weg. Von den Vorträgen im Bildungsinstitut Möschberg her ist ihnen der Anwalt Beat Müller bekannt, Sohn des Gründers Hans Müller. An ihn wenden sie sich. Seine Reaktion: «Endlich wird jemand aktiv! Seit Jahren liege ich meinem alten Herrn in den Ohren, dass etwas gehen muss. Seit dem Tod meiner Mutter passiert im Biolandbau nichts mehr.» Beat Müller beruft Werner Scheidegger und dessen Kollegen, Sämi Vogel und Fritz Buser zu sich ins Büro. Er rät zur Gründung einer Firma – die juristische Form der Genossenschaft sei die in der Landwirtschaft übliche Organisationsform. Der Anwalt hilft auch beim Entwerfen der Statuten. «Vermarktung nicht nur von Geräten, sondern auch von Produkten» wird im Zweckartikel der Gründungsstatuten festgehalten.
Der Name sitzt!
Das Kind braucht einen Namen. Etwas mit Bio soll es sein. Der Ausdruck «Bio-Vermarktung» ist den Gründungsmitgliedern zu schwerfällig. In der Runde denken sie laut nach, pröbeln mit Wörtern herum. Aus «Verm..» wird plötzlich «Farm». Bingo! «Bio-Farm-Genossenschaft», das soll es sein!
Gründungsmitglieder


Biofarm-Pioniere: (v.l.) Ruedi Lüscher, Fritz Buser, Hans Grieder, Samuel Vogel, Werner Scheidegger und Beat Müller.
Im Juli 1972 lädt die junge Biofarm zur Vorführung ihres Abflammgerätes ein. Gebaut hat es die Firma Koller in Kerzers FR. Der selbstfahrende Prototyp, angetrieben von einem Motormäher, versammelt in Fräschels FR einige Neugierige. Kurz nach dem Start fängt die Benzinleitung des Antriebsmotors Feuer. Alle rennen in Deckung und schauen in sicherer Entfernung zu wie die Träume der Biofarm Pioniere in Flammen aufgehen…
Augenzeuge Werner Scheidegger berichtet: «Unser Optimismus war aber nicht dem Feuer zum Opfer gefallen. Wir experimentierten weiter, verlegten uns auf eine traktorgezogene Version». Die Vorführungen dieser zweiten Maschine, ein Jahr später, locken viele Interessierte an. Drei Tage nach der Demonstration sieht es zwar ganz so aus, als sei mit dem Unkraut auch noch das Getreide vernichtet. Doch es erholt sich, und drei Wochen später ist kaum noch ein Unterschied zum unbehandelten Teil zu sehen – ausser, dass effektiv weniger Unkraut nachwächst.
Weiter getüftelt
Im Frühling 1973 werden mit knapper Not die ersten Abflammgeräte fristgerecht geliefert. Kaum ist die erste Maschine eine halbe Stunde im Einsatz, läutet beim Biofarm-Präsidenten das Telefon Sturm. Die Gasschläuche sind undicht. Was jetzt? Die Herstellerfirma wimmelt ab: «Das kann nicht sein, das sind die besten Schläuche auf dem Markt!» Der Biofarm hilft das wenig. «Wir sind dann selber darauf gekommen, dass die Schläuche zu nah an die Brenner herangeführt waren. Durch die aufsteigende Hitze wurde der Kunststoff weich und löste sich aus den Briden», erzählt Werner Scheidegger. Sondereinsatz und Verbindungsstücke aus Metall bringen eine behelfsmässige Lösung. Die Geräte dieser ersten Serie müssen nachgerüstet werden. Das kostet die junge Genossenschaft mehr als die Verkaufsmarge und ziemlich viel Nerven.
In Rauch aufgelöst
Auf der Suche nach dem Bau einer weiteren Serie führt der Zufall die Biofarm-Pioniere mit dem Gasspezialisten Rudolf Haueter zusammen. Eine langjährige Zusammenarbeit beginnt, führt aber nie zum Geschäft. Modell 74, die zweite Serie Abflammgeräte, ist technisch besser ausgereift, die Frage der Gasdosierung bestens gelöst, die Handhabung markant verbessert. Dennoch sind die Geräte kaum verkäuflich: zu teuer für die Landwirtschaftsbetriebe, und der überbetriebliche Einsatz führt rasch zu einer Sättigung des Marktes. Jahrelang belasten die unverkauften Geräte die Bilanz. Nur dank des grosszügigen Darlehens eines Gründungsmitglieds entgeht die Biofarm im dritten Geschäftsjahr der Pleite. Eine unerwartete Renaissance erleben die Abflammgeräte 1988, als so manche Gemeindeverwaltung, durch Atrazinrückstände im Trinkwasser aufgeschreckt, nach Alternativen für öffentliche Areale sucht. Und auch das Interesse der Zürcher Friedhöfe an den fahrbaren Geräten vermag nicht über die Tatsache hinwegzutäuschen: Längerfristig wird die Genossenschaft nicht in der Lage sein, Weiterentwicklung und Service zu gewährleisten. Ein vielversprechendes Gründungsmotiv löst sich in Rauch auf.
Gründungsmitglieder


Abflammgerät
Bei der Gründung der Biofarm stehen zwar die Entwicklung der Abflammgeräte sowie die Fleisch- und Milchvermarktung im Vordergrund, aber zum zweiten brennenden Thema wird die Schweinemast. Auf der Suche nach Fleischabsatz treffen die Pioniere auf einen Metzger, der für seine Biosalami-Produktion Interesse an nicht weniger als 2000 Schweinen pro Jahr zeigt. Doch woher alle diese Bioschweine und die Riesenmengen an Biogerste beschaffen, die so viele Tiere verschlingen? Ein Vorstandsmitglied reist zur Abklärung nach Frankreich. Futtermischungen werden zusammengestellt. Man schickt an alle bekannten Betriebe einen Fragebogen punkto Schweineproduktion. Wenige Monate später verläuft das Biosalami-Projekt im Sand. Es fehlt an Verdienstmöglichkeiten und… an genügend Schweinen.
Glück aus dem Elsass
An einem Landbaukurs auf dem Ausbildungszentrum Möschberg lernt Biofarm-Präsident Werner Scheidegger einen Maschinenbauer aus dem Elsass kennen. Dieser bietet ihm die Schweizer Vertretung für die Elsässer Getreidemühle an. «Im Vorstand haben wir lange beraten und abgewogen», so Werner Scheidegger. «Schliesslich überwog die Meinung, dass Leute, die selber Körner mahlen und Brot backen, ja schon recht nahe am biologischen Gedankengut seien.» Die Biofarmer versprechen sich mit dem Verkauf eines Dutzend solcher Mühlen zudem einen Beitrag an die durch die missglückte Abflammerei entstandenen Unkosten. Die Reaktionen auf ihr erstes Inserat übertreffen alle Erwartungen: In kürzester Zeit sind die ersten zehn Mühlen verkauft; 100 Stück werden es im ersten Jahr. Vorführraum ist die Wohnstube von Familie Scheidegger in Madiswil. Viele Jahre noch bleiben die Elsässer Getreidemühlen eines der wesentlichen Standbeine. Und: Sie sind der eigentliche Auslöser für das bis heute wichtige Getreidegeschäft. In aller Eile müssen die Pioniere im Frühjahr 1974 einige hundert Kilo Bioweizen organisieren. Die meisten Bauern haben dazumal ihr Getreide schon abgeliefert. Biolandwirt Ernst Frischknecht in Tann ZH kann einspringen und wird der ersten Biofarm-Produktelieferant.
Gründungsmitglieder
Hinter all ihren Bemühungen um Sortimentserweiterung mit Bioprodukten aus dem Inland stellt sich für die junge Biofarm bald eine Grundsatzfrage: Soll sie als schweizerische Bauerngenossenschaft überhaupt Importprodukte in ihr Sortiment aufnehmen? Bei Produkten, die aus klimatischen Gründen nicht im Inland gedeihen können, fällt die Antwort leichter. Doch konkurrenziert sie mit allem anderen nicht die eigenen Mitglieder? Die Pioniere gelangen schliesslich zur Überzeugung, dass sich inländische Körner mit einer für den Detailhandel interessanten Sortimentsbreite besser verkaufen lassen, denn für die Ladener lohnt eine Bestellung erst, wenn sie möglichst viele Artikel beim gleichen Lieferanten beziehen können. Biofarm-Präsident Werner Scheidegger: «Wir haben uns immer die Einschränkung auferlegt, zuerst die inländischen Produzenten zu berücksichtigen und erst zu importieren, wenn ihr Angebot nicht ausreicht.»
Leader-Produkt im Gartenhäcksler
Dass ausgerechnet brasilianischer Vollrohrzucker das Leader-Importprodukt werden würde, hätte niemand gedacht, als sich eines Tages ein unbekannter Schweizer Auswanderer bei der Biofarm meldet. Emilio Lutz bewirtschaftet mit seiner Frau die Fazenda Jacutinga. Er hat auf Bio umgestellt und ist auf der Suche nach Abnehmern in Europa. Er möchte aus Zuckerrohr – nicht wie die meisten anderen Treibstoff –, sondern wertvollen Vollrohrzucker herstellen. Für die Genossenschaft stellt sich die Frage, ob die Aufnahme eines solchen Nischenproduktes gerechtfertigt und sinnvoll ist. Die Absatzchancen schätzt der damalige Präsident Werner Scheidegger als gering ein. Hinzu kommen restriktive Vorschriften für den Import, insbesondere die Pflichtlagerhaltung. Nach einigem Hin und Her entschliesst man sich dennoch zu einem Versuch. Der erste Container mit 16 Tonnen trifft ein. Aber oha: Vollrohrzucker nimmt Luftfeuchtigkeit auf und klumpt. Entsprechende Beutel sind anzufertigen. Normalerweise werden solche Produkte in klimatisierten Räumen gelagert und verarbeitet, doch davon kann man in Kleindietwil nur träumen. Weil schon die Originalsäcke aus Brasilien die Feuchtigkeit ungenügend zurückhalten, ist oft der ganze Sackinhalt (25 kg) ein einziger Klumpen, den es vor der Abfüllung in Kleinpackungen zu zerstampfen gilt. Es lässt sich eine Lösung finden: Der Sackinhalt kommt durch den Gartenhäcksler. Später wird das Produkt in Plastiksäcken angeliefert, und diese Improvisation erübrigt sich. Durch ihren Mut zu Neuem trägt die Biofarm einmal mehr dazu bei, Bio-Suisse-Richtlinien zu entwickeln – diesmal für den Anbau von Zuckerrohr.
Gründungsmitglieder
Um 1975 geraten die Pioniere ungewollt auf Kollisionskurs mit der Anbau- und Verwertungsgenossenschaft Galmiz (heute Terraviva). Durch die Ölkrise ist der Kurs des Schweizerfrankens deutlich gestiegen, was die schweizerischen Exportprodukte verteuert. Betroffen davon ist auch die Biotta in Tägerwilen TG. Bei ihr kommt es zu einem «Saftstau», weshalb ihre Lieferanten den Anbau von Rüebli und Randen vorübergehend einschränken müssen. Obwohl die Pioniere nicht ins Gemüsegeschäft einsteigen wollen, kommt die Idee auf, Reformhäusern Aktionen mit Biorüebli vorzuschlagen. Der damalige Präsident des Verbandes Schweizer Reformhäuser biona lehnt ihre Anfrage ab mit der Begründung, ein Reformhaus sei nicht auf Frischprodukte ausgerichtet. Er weist jedoch darauf hin, dass der Verband landwirtschaftlicher Genossenschaften von Bern den Gemüsesaft Eden in Lizenz für den Schweizer Markt herstelle. Das Geschäft kommt zustande. 30 bis 50 Tonnen Rüebli und Randen pro Jahr kann die Biofarm während einiger Jahre liefern.
Biona, Pionier, Morga und eine eigene Linie
Das Geschäft mit Saftgemüse wird kein tragender Betriebszweig, doch führt es die Pioniere auf eine wegweisende Fährte: Bioprodukte, also auch Getreidekörner, in Kleinpackungen zu lancieren – eine grosse Neuheit für die damalige Biokundschaft. So beginnt eine langjährige Zusammenarbeit mit dem biona Verband. Den Anfang machen Weizen- und Roggenkörner unter der Marke biona. Die Feinverteilung an die Reformhäuser übernimmt die Firma Pionier in Wädenswil ZH, die später an die Morga AG in Ebnat-Kappel SG übergeht. Eine eigene Verteilung aufzubauen oder die Reformhäuser mit Bahn oder Post zu beliefern, würde die Ware zu sehr verteuern. Bald erweitern Gerste und Hafer das Sortiment. Die Frage beschäftigt: Wer kann Kleinmengen in guter Qualität und zu vernünftigen Preisen schälen und reinigen? Präsident Werner Scheidegger macht seine Erfahrungen: «In der Hafermühle Lützelflüh wurde ich vom Obermüller ausgelacht: ‘Bis ich die Maschine richtig eingestellt habe, ist schon die ganze Charge darin verschwunden’». Die Steigmühle Töss in Winterthur ist bereit, Kleinaufträge zu übernehmen. Mit den wachsenden Mengen sagt schliesslich die Hafermühle Lützelflüh zu. Das biona-Sortiment wird in den Folgejahren laufend ausgebaut. Grahammehl kommt hinzu, Ruchmehl und Weissmehl, später folgen Hirse, Buchweizen, Leinsamen und anderes mehr. Die gute Zusammenarbeit mit dem biona-Verband und die eigene Abfüllanlage für Kleinpackungen motivieren, auf eine eigene Linie unter der Marke Biofarm zu setzen.


1975 führt die Biofarm neben der Verpackung des biona-Verbandes erstmals ihre eigenen Kleinverpackungen ein.